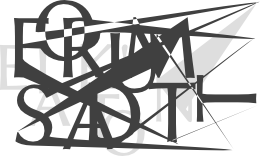Ein Aufenthalt im alten Westberlin im Frühjahr 1981, wo es mir ein Künstlerstipendium dankenswerterweise erlaubte, den Roman Landschaften nach der Schlacht in Ruhe abzuschließen, verdeutlichte mir eindrücklicher als jede Abhandlung die Funktionsweise der Maschine Zeit und ihres Anteils an dem destabilisierenden Bild dessen, was wir in der Nachfolge Baudelaires und Benjamins als künstlerische und literarische Moderne verstehen.
Ich hatte mir eine einfache Wohnung im damals an der Peripherie gelegenen Kreuzberg gesucht – unweit des Kanals, in den man 1919 die Leiche der großen Revolutionärin Rosa Luxemburg geworfen hat –, eine Wahl, die gleichermaßen meiner beklagenswerten Unkenntnis des Deutschen wie dem Wunsch nach Vertiefung meiner Türkischkenntnisse geschuldet war. Regelmäßig spazierte ich durch die Oranienstraße und zu einer Aussichtsplattform, die den Blick auf ein durch Stacheldraht, Gräben, Wachtürme und nächtliches Flutlicht gesichertes Niemandsland freigab, also auf das ganze von der Deutschen Demokratischen Republik sorgsam ersonnene Arsenal zur Abschreckung etwaiger Paradiesflüchtlinge.
In einem „Berliner Chronik“ betitelten Artikel, der in El País erschien und später in eins meiner Bücher aufgenommen wurde, beschreibe ich diese fragmentierte, fast schizophrene Realität, die die Berliner beider Seiten zu völligen Fremden machte:
Selbst ein kurzer Berlin-Aufenthalt reizt den Fremden vor allem zu einer fruchtbaren Betrachtung des Raums. Vom Krieg zerstört, durch die unregelmäßige, zwanghafte Grenzziehung einer absurden Mauer geteilt, hat die ehemalige Hauptstadt des Reichs und der bescheideneren und interessanteren Weimarer Republik ihr Gravitationszentrum verloren, und zumindest im Westsektor bietet sich ihm der Blick auf Brachflächen, Wälder, unkrautüberwucherte Flächen und leeres Ödland: ein extravagantes ökologisches Paradies. Aus dem Luftschiff der Hochbahn, die Kreuzberg durchquert, entdeckt er erstaunt die Ausbreitung von Wiesen und freien Feldern in vormals dicht besiedelten und pulsierenden Gebieten. Wie Pompeji oder Palmyra verwandelt uns der zentrale Stadtteil Tiergarten mit dem Potsdamer Platz hinterlistig in Forscher und Archäologen. Aber seine Ruinen sind keine zweitausend Jahre alt: so unwahrscheinlich es scheint, bringen sie es kaum auf ein halbes Jahrhundert.
Mit einem Stadtplan des alten Berlin in den Aufzug zu steigen, der zu dem neben einem Atombunker errichteten Aussichtspunkt fährt, und von dort das Panorama zu überblicken, das die graue Linie der Mauer und die beiden Hälften der verwüsteten Stadt umfasst, ist nicht nur eine direkte Einladung zur mentalen Verdopplung und Schizophrenie; es ist ein verworrenes, traumhaftes Schauspiel, das ohne Zuhilfenahme halluzinogener Drogen die wundersame historische Unwirklichkeit resümiert, in der wir leben.