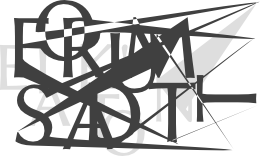Haralampi G. Oroschakoff
Paris Bar oder: wenn sie nicht elegant sind, dann bemühen sie sich um eine eigene Note*
Ernest Hemingway
Ich bewege mich gemessenen Schrittes die Fasanenstrasse entlang, passiere die Villa Griesebach und trete nach dem Literaturhaus aus dem gedämpften Gelb der diskreten Straßenlaternen auf den Kurfürstendamm. Das Kino auf der anderen Straßenseite ist einem Tommy Hilfiger Flagshipstore gewichen und leuchtet grell den Fußgängerübergang aus, als ich die dreispurige Fahrbahn erreiche. Der Verkehrsstrom nötigt mir Aufmerksamkeit ab, ich verlangsame meinen Bewegungsablauf, überquere die Breite und tauche in die Berliner Prachtmeile ein. Am Kempinski vorbeigehend, der Portier in seiner Livree grüßt mit einer Zuckung der rechten Augenbraue, erreiche ich die Kunsthandlung Gunti, vis à vis der jüdischen Gemeinde in ihrem 60er Jahre Zweckbau. Ich betrachte die afrikanische Maske in ihrem roten Ambiente im kleinen Schaufenster – eine stille Ehrwürdigkeit in Holz auf ihrer cognacfarbenen Stele ruhend. Bei Springer gibt es Farbe auf Leinwand, der Avantgarde des Aufbruchs längst entleibt. Im Weitergehen erscheint das Delphi-Lichtspieltheater formatfüllend im Ausschnitt, während ich in die Kantstrasse abbiege. Der jäh einsetzende Luftzug zwingt mich, den Mantelkragen hochzustellen, ich beschleunige meinen Schritt. Das Rotgrün der Paris Bar gegenüber spiegelt sich im Pflaster. Eine seltsame Gereiztheit nimmt Besitz von mir: kein Ort zum Wohlfühlen, denke ich die Tür öffnend.
Ich setze mich. Reinald Nohal thront hinter der staubfreien Caisse in der Manier eines Offiziers mit Trapperallüren. Hintern raus, Bauch rein, nie ohne Averna.