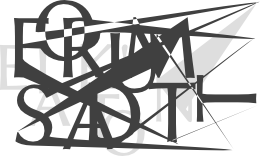Wer wie ich in Wien aufwächst, dem sind Kaffeehäuser vertraut: rauchgeschwängerte Biotope in abgesessenem Samt der Selbsterfindung, stellen sie Bühnen her, die von Bon Vivants, Müßiggängern, Dampfplauderern, scheintoten Heuchlern, Künstlern, Künstlerdarstellern und wirklichen Aristokraten bewohnt wurden. Zwischen Depressiönchen und Frohsinn angesiedelte Sprachfetzen bilden sie die gnadenlose Schule aus, die mich für all die wenigen Etablissements, das Flore, Coupole, Schumanns und Chunga-Bar, im Spiel der bitterbösen Darstellung vorbereitet hatte. Gelebte Stundengläser innerhalb der Illusion von Freiheit, deren Grenzenlosigkeit greifbar schien. Draußen, im grauen Wien meiner Jugend, herrschte neben den diversen Privatschulen, der Bürgerkriegszustand im verlebten Austrofaschismus, begleitet von der keifenden Dumpfheit der Straße. Der maßgeschneiderte Humor, diese vernichtende Waffe im Meer der Ungebildetheit und Dummheit, hatte nach 1000jährigem Triumph als strahlendes Haupt der Vielstimmigkeit ein Universum der Schrumpfung hinterlassen – die glorreiche Habsburger Monarchie war auf die Form einer Mozartkugel zurechtgekocht worden, mit einer überdimensionierten Beule. Seitdem belügt sich Wien am Gleichgewicht entlang. In diesem Zustand des verkleideten Mangels, von hochherrschaftlichen barocken Fassaden umzingelt, wurde mir klar, dass es außerhalb der künstlerischen Vorstellung keine objektive Darstellung des erhofften Ankommens, noch dessen Erfüllung gibt. Das Kräftemessen hatte im ununterbrochenen Beweisen müssen vor dem gnadenlosen Auge der ›Galerie‹ stattzufinden. Ohne Aussicht auf Anerkennung agieren zu müssen, verortete den befürchteten Gesichtsverlust – niemals vor sich selbst – zum Gradmesser der Schleimproduktion in dessen kleinbürgerlichem Gewande. Im ›Bermudadreieck‹ des 1. Bezirks, zwischen Hawelka, Oswald & Kalb, Alt-Wien und dem Korander hingen verblichene Plakate, angerissene Fotos und vergilbte Artefakte herum, auf denen »Die Schasstrommel«, »Kunst & Revolution« oder »Zock–Fest« im poppigen Layout auffielen. Zwischen meinen väterlichen Freunden Gert Jonke und Reinhard Priessnitz (Gott habe sie selig!), lernte ich als aufmüpfiges Kind, dass es anno 1967 im Veranstaltungssaal des Gasthauses »Zum grünen Tor« zu einem sorgfältig vorbereiteten Auftritt von Otto Mühl, Oswald Wiener, Hermann Nitsch und Peter Weibel gekommen war, vom Conferencier Michel Würthle situationistisch geführt; dazwischen gab’s zielsicheren Knödelbeschuss, Fleischwürfe, epileptische Anfälle, Beschimpfungen, poetische Manifeste zur Weltlage – das »Zock-Fest« erscheint im Rückblick legendär. Ich hatte Michel sporadisch in Wien bemerkt: er war älter als ich, auffallend in seiner altösterreichischen Eleganz und, wie die Frauen meinten, schön wie ein Gott. Als nächtlicher Umherschweifender (das dérive der Lettristen leuchtete mit den Weg aus) – suchte ich die Waage zwischen elterlichem Traditionalismus und der Hingabe an eine Szenerie, die mir auferlegte, mich ohne festen Kurs dem Spiel der Umgebung auszusetzen. Schnell Entscheiden oder sich abwenden, um neue Gewohnheiten anzunehmen und blitzartig der Gefahr zu begegnen. Zu diesem Zeitpunkt ahnte ich nicht, dass Michel diese Methode auf der Grundlage scharfer Beobachtung längst zur dynamischen Schnitt- und Montagetechnik seines Lebens verfeinert hatte – Konrad Bayer sei Dank.