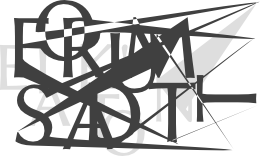Diana drapierte das Tragetuch sorgfältig um die drei Monate junge Dara, während Michel und ich zu Martin Kippenbergers U-Bahn-Schacht spazierten – die griechische Sonne Syros verbrannte uns die Schulterblätter. Das Meer am Horizont suchend, dachte ich an Samuel Becketts Roboter, verharrend im ewigen Wartezustand, und nichts erschien mir in diesem Augenblick widersinniger. Das Exil bleibt das Riesenreich der Schatten, im Grunde fahren wir nirgendwohin. Die großen Einzelgänger, ich denke an Ezra Pound, Vladimir Nabokov, Gottfried Benn, Celine oder Walter Benjamin, die so bewundert wie verfemt wurden, forcierten und beschleunigten in jenen historischen Tagen der Avantgarde den Gedanken an eine Utopie, die noch grenzenlos schien. War es ein beschleunigter, ein geheimer Ort der Schönheit in seinem einsamen Gewande oder öffentlich zelebrierte Missachtung des Vorgefundenen? Vielleicht Beides. Umhertreiben in einem Lexikon der Sprache, um die Gedanken umzuleiten. Übriggeblieben sind die objektivierten Formen dieser Spurensuche, als eigene Wirklichkeit.
Heute ist Zeit eine Konstante, wahrnehmbar in der persönlichen Entscheidung, ansonsten so identitätsstiftend wie Shopping-Malls allerorten. Ich denke an Francis Picabias Aussage, dass… »es keine Kunst und keine Krankheit gibt, wohl aber Kranke. Die Menschen, die sich über das Werk der Anderen äußern, tragen immer nur sterilisierte Ideen bei, gefilterte Ideen, die erst einen karteiartigen Filter passieren müssen, bevor sie von Mode und Konvention akzeptiert werden.« Das Ebengesagte verwandelt sich in eine Fülle von Empfindungen, und in diesem Augenblick erlebe ich die Paris Bar in ihrer Künstlichkeit als schützenswertes Individuum, als letzte Welle der Bohème.